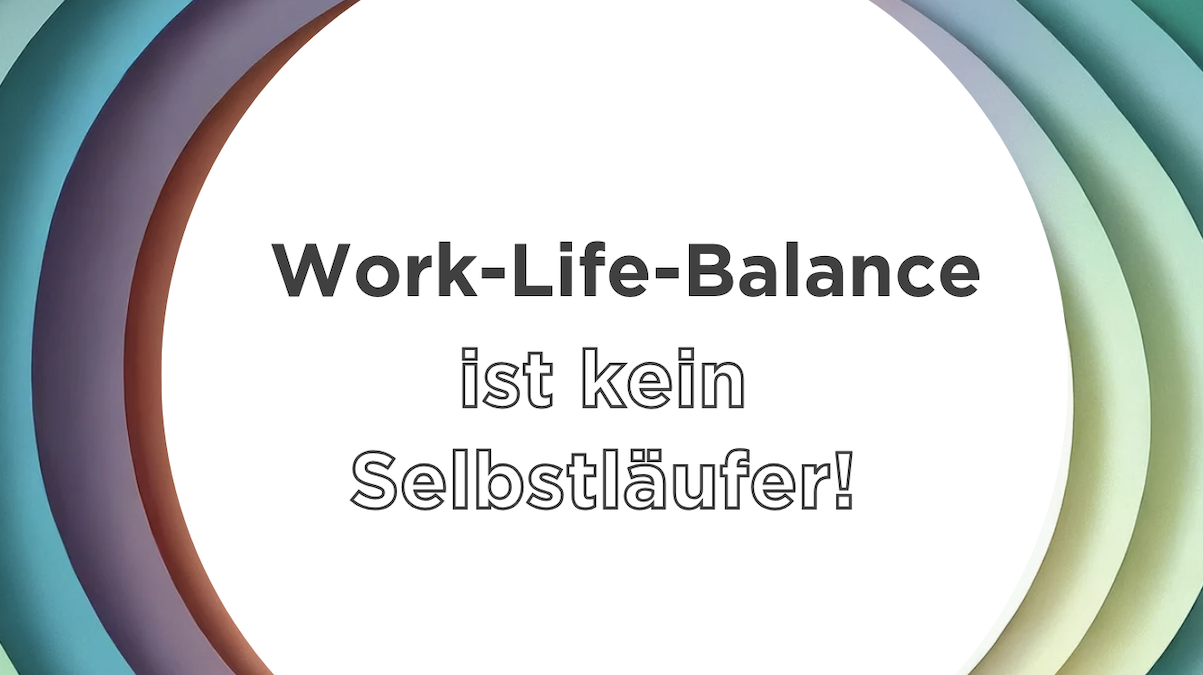Prof. Dietrich Grönemeyer: „Ein Leben ohne Angst ist möglich”
Angst ist allgegenwärtig – aber muss sie auch unser Leben bestimmen? Im Interview erklärt Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer, was wir tun können, um mutig, gesund und gelassen durch unsichere Zeiten zu gehen – und warum die Seele genauso viel Aufmerksamkeit braucht wie der Rücken, weil am Ende auch beides miteinander korrespondiert.
"Es ist entscheidend, sowohl den Körper als auch
die Seele zu behandeln."
Was hat sie motiviert, sich mit dem Thema “Leben ohne Angst” auseinanderzusetzen?
Prof. Dietrich Grönemeyer: Ich bin seit fast 40 Jahren intensiv in der Behandlung von Rückenerkrankungen als Arzt und Radiologe tätig. Die Menschen, die zu mir kommen, sind oft von Ängsten geplagt und stehen unter maximalem Stress im Alltag, was sich direkt auf ihren Rücken auswirkt. Dieser Stress führt zu verhärteten Muskeln und Verspannungen.
Was wir an negativen Erfahrungen oder Gefühlen, zum Beispiel durch Stress oder Ängste ausgelöst, in uns tragen, schlägt sich oft genug in einer gekrümmten Haltung nieder. Deshalb ist es so wichtig, sich die eigenen Gefühle wie zum Beispiel Ängste bewusst zu machen und negative aktiv ins Positive zu verwandeln. Das ist mein Ansatz. Interessanterweise sind nur drei Prozent aller Rückenschmerzen durch die Bandscheibe bedingt, während 80 Prozent auf Muskelverspannungen zurückzuführen sind, die stark mit Angst und Stress zusammenhängen.
Als ich diese Zusammenhänge erkannte, wurde mir klar: Die lokale Behandlung ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist der Mensch selbst – seine Ängste, sein Stress und die emotionalen Schwierigkeiten, die zu einer inneren Verkrampfung führen. Es ist entscheidend, sowohl den Körper als auch die Seele zu behandeln und darüber zu sprechen.
Daher begann ich, über Rückenschmerzen zu schreiben, und mittlerweile schreibe ich über ein erfülltes Leben – ein Leben, das von Begeisterung geprägt ist und in dem wir dankbar für das Geschenk des Lebens ohne Angst sein können.
Prof. Dietrich Grönemeyer im Gespräch mit pme-Redakteurin Christin Müller.
Was kann geschehen, wenn Ängste nicht behandelt werden?
Prof. Dietrich Grönemeyer: Die Auswirkungen sind vielfältig und können zu psychischen Erkrankungen wie generalisierten Angststörungen, Panikattacken oder Depressionen führen. Die Stresshormone, die bei Angstzuständen ausgeschüttet werden, fördern Entzündungen, die wiederum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes erhöhen. Darüber hinaus können sich diese emotionalen Belastungen auch in körperlichen Beschwerden wie Rücken-, Kopf- oder Bauchschmerzen äußern. Es gibt viele Wechselwirkungen. So leiden Menschen mit Rückenschmerzen häufig an Depressionen, Angstzuständen oder Schlafstörungen.
Wie zeigt sich eine Angststörung und wie unterscheidet sie sich von einer gesunden Angst?
Prof. Dietrich Grönemeyer: Angststörungen sind eine Herausforderung, die sich nur schwer in den Griff bekommen lässt. Sie überwältigen dich, lassen dich nachts aufschrecken und rauben dir Schlaf, wodurch man in einen Teufelskreis gerät. In solchen Fällen ist oft eine psychologische oder psychiatrische Behandlung notwendig. Menschen, die unter Burnout leiden, depressiv und im schlimmsten Fall suizidgefährdet sind, befinden sich in dramatischen Situationen.
Darüber hinaus gibt es posttraumatische Störungen, die nach traumatischen Erlebnissen wie Kriegen, Vergewaltigungen oder Missbrauch auftreten. Diese schweren Erfahrungen erfordern unbedingt die therapeutische Unterstützung von Ärzt:innen, Psycholog:innen oder Psychiater:innen, um den Betroffenen zu helfen, mit ihren Erlebnissen umzugehen und Heilung zu finden.
Es gibt jedoch auch alltägliche Ängste, wie die Furcht vor dem Fliegen, vor Spinnen oder im Job vor den Kollegen oder dem Chef. Sorgen über Kinder, den drohenden Arbeitsplatzverlust und ähnliche Themen können ebenfalls extrem belasten. Es ist aber wichtig, hier eine klare Unterscheidung zu treffen.
Laut einer aktuellen Studie des RKI leiden 13,1 Prozent der Erwachsenen und darüber hinaus auch immer mehr Jugendliche unter auffälligen Angstsymptomen. Was können in der heutigen Zeit die Gründe dafür sein?
Prof. Dietrich Grönemeyer: Die Pandemie hat deutlich gezeigt, wie ernstzunehmend die Ängste der Menschen sind: die Angst vor Corona, vor schweren Erkrankungen, vor dem Tod und sogar vor der Impfung. Leider wurde auf diese Ängste oft nicht ausreichend eingegangen. Ich kann das gut nachvollziehen, denn ich war als Kind ein totaler Schisser, wenn es um Spritzen ging – ich bin oft davongelaufen oder sogar ohnmächtig geworden.
Dennoch bin ich ein Impfbefürworter, denn Impfungen, etwa gegen Grippe oder Tetanus, können oft Krankenhausaufenthalte und schwerwiegende Therapien vermeiden. Es ist mir lieber, nicht ständig zum Arzt laufen zu müssen, wenn ich durch Impfungen präventiv helfen kann. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die Pockenimpfung, die dazu geführt hat, dass diese Krankheit weitgehend ausgerottet ist, auch wenn es in einigen entlegenen Regionen der Welt noch bzw. wieder sporadische Ausbrüche gibt.
Besonders junge Menschen haben derzeit große Angst vor der Zukunft: vor möglichen Kriegen, der Frage, ob sie selbst in den Krieg ziehen müssen, und vor der Inflation. Die Angst, den eigenen Wohlstand zu verlieren, ist ebenfalls sehr präsent und belastet sie stark. Eine Dresdner Studie hat gezeigt, dass nur 13 Prozent der jungen Menschen bereit sind, Therapieangebote anzunehmen. Sie scheinen mehr in sich gefangen zu sein, was es uns als Ärzte erschwert, zu ihnen durchzudringen und Unterstützung anzubieten.
 Prof. Dietrich Grönemeyer spricht offen über seine Ängste und wir er sie behandelt hat.
Prof. Dietrich Grönemeyer spricht offen über seine Ängste und wir er sie behandelt hat.
Und wie können wir Menschen in Anbetracht der aktuellen Sorgen über Krieg, Klimawandel und ähnliche Herausforderungen mit diesen Ängsten umgehen, ohne in Panik zu verfallen?
Prof. Dietrich Grönemeyer: Ich sage immer: Die Zeiten waren schon immer herausfordernd. Solange ich zurückdenken kann, gab es immer wieder dramatische Situationen, mit denen wir uns konfrontiert sahen – von der Ölkrise, bei der tagelang die Straßen unbefahrbar waren, über den drohenden Dritten Weltkrieg während der Kubakrise, bis hin zu Tschernobyl, Fukushima und dem Balkankrieg, der ganz in unserer Nähe stattfand. Es war nie einfach.
Trotz alledem glaube ich, dass es wichtig ist, mutig zu sein. Wir sollten uns selbst mehr an die Hand nehmen und das Leben da genießen, wo es genießbar ist – mit Freude und Lachen, selbst in schweren Zeiten. Die gute Botschaft dahinter: Ein Leben ohne Angst ist möglich.
Ich habe das Gefühl, dass wir oft zu sehr von uns selbst entfernt sind. Wenn wir in den Medien die unterschiedlichsten Nachrichten lesen, ist es manchmal hilfreich, einen Media Detox oder Digital Detox zu machen. So können wir wieder zu uns selbst finden und herausfinden, was uns wirklich guttut, was uns Freude und Kraft gibt. Ob es der geliebte Mensch, der Partner oder die Partnerin, die Kinder oder auch Kollegen und Kolleginnen sind – selbst das Lächeln eines Fremden.
Ein Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen, unabhängig davon, ob sie die gleiche Sprache sprechen oder nicht. Diese offenen Augen und die Möglichkeit, das Leben zu erfahren, sind ein riesiges Geschenk.
Aber ist es immer sinnvoll, sich in angsteinflößenden Situationen mit schönen Gedanken abzulenken?
Prof. Dietrich Grönemeyer: Es ist grundsätzlich sinnvoll, mutig und liebevoll mit sich selbst, mit anderen Menschen und auch mit der Umwelt umzugehen.
Die Grundhaltung sollte sein: Liebe dich selbst, dann kannst du auch Nächstenliebe praktizieren. Doch es gibt Situationen, in denen wir aus einem gedanklichen Teufelskreis nicht herauskommen.
Wenn ich beispielsweise Höhenangst habe oder Angst vor Spinnen oder Mäusen, hilft oft die Konfrontation mit diesen Ängsten. Allerdings ist es in der Regel schwierig, dies allein zu bewältigen – hier benötige ich Unterstützung. Wenn ich durch schwere Situationen gegangen bin, dann ist professionelle Hilfe notwendig. Ich erinnere mich an meine eigenen Erfahrungen: Nach einem Sturz aus zehn Metern Höhe in den Bergen, bei dem ich dachte, mein Leben sei vorbei, spürte ich dennoch eine innere Ruhe und Geborgenheit und dachte: „Wenn es gleich nicht weitergeht, dann ist es so“. Mir wurde bewusst, dass ich ohne Angst leben kann. Mit dieser Haltung lebe ich bis heute.
Jeder Flug, den ich danach unternehmen musste, war für mich eine Herausforderung. Obwohl ich früher ein begeisterter Flieger und auf allen Kontinenten wissenschaftlich tätig war, bereitete mir jedes Schaukeln auf einmal immense Panik. Doch ich stellte mich dieser Angst und fliege heute wieder mit Begeisterung. Das heißt, ich habe mich damit selbst konfrontiert, weil es keinen Ausweg für mich gab.
Inwiefern kann die intensive Nutzung von TikTok und Co. das Angstempfinden der Menschen verstärken?
Prof. Dietrich Grönemeyer: Soziale Medien sind nicht grundsätzlich schlecht, sie können auch wertvolle Informationen bieten. Dennoch ist es entscheidend, wie wir damit umgehen. Es gibt ein altes Sprichwort von Paracelsus: „Die Dosis macht das Gift“. Das trifft besonders auf unsere Nutzung digitaler Medien zu. In Krisenzeiten sind viele Menschen ständig online, um die neuesten Nachrichten zu verfolgen.
Dieses Verhalten, das wir als Doomscrolling kennen, kann jedoch schädlich sein. Unser Gehirn ist darauf programmiert, Gefahren besonders wahrzunehmen, was dazu führt, dass wir uns stärker auf negative Nachrichten konzentrieren. Diese ständige Konfrontation kann unser Angstempfinden erheblich steigern und uns das Gefühl geben, in einer ständigen Bedrohung zu leben.
Wie können wir die Angst als wertvolles Hilfsmittel nutzen, anstatt uns von ihr lähmen zu lassen?
Prof. Dietrich Grönemeyer: Angst ist eine Grundemotion, die uns als Warnsystem dient. Sie kann uns wachrütteln und motivieren, wenn wir sie als Chance sehen, uns zu verändern. Anstatt in den Kampf- oder Fluchtmodus zu verfallen, sollten wir uns fragen: „Wovor habe ich eigentlich Angst?“ und die Ursachen unserer Ängste verstehen.
Wenn wir uns dieser Emotion stellen, können wir handlungsfähig werden und die Angst nutzen, um unser Leben aktiv zu gestalten. Es ist entscheidend, dass wir lernen, die Angst nicht als Feind zu betrachten, sondern als einen Teil unseres Lebens, der uns darauf hinweist, dass Veränderungen notwendig sind.
Viele Menschen haben im Job Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, überlastet zu sein oder nicht mehr mithalten zu können. Was würden Sie diesen Menschen raten?
Prof. Dietrich Grönemeyer: Es ist wichtig, was einem auf der Seele brennt, offen anzusprechen. Ich betrachte mich als Kämpfer für eine wertschätzende Arbeitskultur. Wertschätzung bedeutet für mich, dass ich dem anderen gegenüber zum Ausdruck bringe, dass ich die Arbeit und die Person schätze. Dies gilt sowohl in der Medizin, wo ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe zwischen Arzt und Patient entscheidend ist, als auch im Arbeitsumfeld zwischen Mitarbeitenden, Vorgesetzten und Angestellten.
Dieses Prinzip ist für mich sehr hilfreich. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich meine Probleme ansprechen kann – sei es, dass ich am falschen Arbeitsplatz bin, andere Fähigkeiten habe oder mich zu wenig gelobt fühle – dann fördert das eine offene Kommunikation. Es ist frustrierend, wenn ich mich falsch behandelt fühle, weil ich nur kritisiert werde, anstatt dass wir gemeinsam an einem Problem arbeiten.
Ich träume nicht nur von dieser wertschätzenden Kultur; ich lebe sie als Unternehmer, der über Jahrzehnte 250 Menschen in seinem Unternehmen geführt hat. Es ist mir wichtig, für andere da zu sein, ein offenes Herz und ein offenes Ohr zu haben und gemeinsam Lösungen zu finden, wenn es Schwierigkeiten gibt. Dazu gehört auch, sich selbst zu öffnen und bereit zu sein, miteinander zu sprechen.
Welchen Tipp haben Sie für Menschen, um im Job langfristig mental gesund zu bleiben?
Prof. Dietrich Grönemeyer: Die berühmte Work-Life-Balance ist tatsächlich ein wertvoller Ansatz: Es ist wichtig, Kraft nicht nur im Privaten zu tanken. Arbeit ist Arbeit, aber sie sollte auch Freude bereiten. Manchmal muss man mit zusammengebissenen Zähnen durchhalten, doch es ist entscheidend herauszufinden, was sich verändern sollte.
Im Privaten bedeutet das für mich, die Familie zu genießen und Freundschaften zu pflegen. Gleichzeitig ist es wichtig, auch „Nein“ sagen zu lernen und die eigenen Interessen so zu formulieren, dass andere verstehen, was mir guttut. So wie ich die Bedürfnisse anderer respektiere, sollte ich auch für mich selbst einstehen.
Für mich gibt es keine strikte Trennung zwischen Arbeit und Privatleben; vielmehr sollten beide Bereiche integrativ miteinander verbunden sein. Dennoch ist es wichtig, klare Grenzen zu setzen. Ich lege großen Wert darauf, eine Trennung von meinem Handy und Computer zu schaffen. Es ist entscheidend, sich bewusst Zeiten zu nehmen, um abzuschalten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich nehme mir Zeit für schöne Bücher, genieße die Gesellschaft anderer Menschen, höre Musik, gehe ins Theater oder ins Kino – all die Dinge, die wir in der heutigen Zeit oft vernachlässigen, aber die wirklich wichtig sind.
Wenn man in andere Länder reist, wie Spanien oder Griechenland, wird einem schnell bewusst, wie wertvoll das Leben außerhalb des Alltags ist. Gemeinsam einen Kaffee oder Tee trinken, zu lachen und das Essen zu genießen – all das verlieren wir hierzulande leider zu schnell aus den Augen.
Doch es ist an der Zeit, diese Lebensfreude zurückzuerobern und bewusst zu leben. Und nicht zu vergessen: Lächeln und sich aufrichten, sich gerade machen, auch wenn einem dazu mal nicht zumute ist. Eine aufrechte Haltung wirkt positiv auf die innere Befindlichkeit und hebt das Selbstwertgefühl. Diese guten Wechselwirkungen kann sich jeder zunutze machen.
Das neue Buch: "Leben ohne Angst" von Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer.